|
Im Jahre 764 erstmals urkundlich erwähnt.
Agasul ist bis heute ein sehr ländliches Dorf geblieben.
Sechs eigenständige Landwirte bewirtschaften rund
120 Hektaren
Kulturland und 50 Hektaren Wald. Nebst vielen
Kleintieren werden
105 Kühe und 25 Pferde gehalten. Eine
Lastwagenreparaturwerkstätte
und Transport- und Carunternehmung
prägen die Strassenkreuzung
Illnau – Weisslingen
- Kyburg. Der Mittelpunkt des geselligen Lebens
ist die gemütliche Dorfbeiz, welche weit herum als „Pöstli“ bekannt
ist.
Agasul ist heute weit über die Landesgrenzen hinaus unter
Pferdefreunden durch den
Zürcher Freiberger-Tag
zu einem ungeahnten Bekanntheitsgrad geworden. |
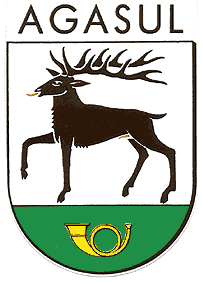 |
|
Das Ortswappen Agasul (eingeweiht am 4.9.1987)
Es zeigt einen schwarzen Hirsch mit roter Zunge, der auf einem silbernem Grund dargestellt ist. Im grünen Schildfuss des Wappens erinnert ein goldenes Posthorn an den Umstand, dass Agasul im
19. Jahrhundert
einmal eine Pferdepost-Haltestelle war.
Der Ortsname Agasul (althochdeusch Aginsulaga)
bedeutete soviel wie „Schweinepferch des Ago“. Weil
im Ort jedoch die Ueberlieferung von einer Hirschtränke (in
alter Schreibweise Agensule) besteht, wählte man als
Wappentier den ansprechenderen Hirsch.
|
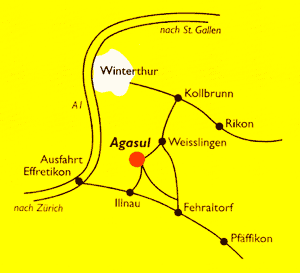 |
Agasul ist
verkehrstechnisch gut gelegen. Nur zwei Kilometer von der
Autobahnauffahrt Rapperswil, St. Gallen und Zürichgelegen.
Auch mit den öffentlichen Verkehrsmittel ist Agasul bequem zu
erreichen. Ab Bahnhof Effretikon und Illnau verkehren regelmässig
ein Personenbusse. |

|
info@weidhofagasul.ch
|
Brauiweiher,
Badiweiher bei Weisslingen / Agasul (ZH) |
|
|
"Wo liegt Agasul?" Immer wieder bringen Geographielehrer damit
Ihre Schüler in Verlegenheit, die dabei an arabische
Küstenstädtchen am Roten Meer denken. Damit hat das kleine
Zürcher Bauerndorf nicht viel gemeinsam.
Die Entstehung des von Agasul in Richtung Weisslingen
liegenden Brauiweihers verdanken wir dem Durst unserer
Vorfahren. Von 1985 bis 1903 bestand an der Strasse von
Weisslingen nach Agasul-Illnau die kleine Brauerei Wagner, an
welche heute noch das 1891 eingerichtete Wirtshaus «Brauerei»
und der «Brauiweiher»
erinnern. Aus dem Weiher wurde das für die Kühlung nötige Eis
gebrochen.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Eismaschinen in
Betrieb nahmen, blieb der Kampf ums Eis eine ständige
Herausforderung. Die Walkeweiher in Winterthur z.B. waren dem
«Haldengut» vorbehalten. Sie wurden ständig vertieft und
ausgedehnt, aber nicht immer konnten die nahen Gewässer den
Eisbedarf decken. Der milde Winter 1876/77 zwang gar dazu, das
Eis vom Klöntalersee herbeizutransportieren.
Gleich vorweg gesagt: Wegen dem Baden alleine würde ich
unbedingt bis hierher fahren. Auf der schmalen Liegewiese
liegt Ihr Handtuch fast neben der Strasse. Es fehlen Toiletten
und Duschen. Im Naturschutzgebiet ist Freizeitnutzung
eingeschränkt: Hunde müssen die Leine, Schwimmkörper sind
verboten, ebenso das Baden in der westlichen Weiherhälfte, die
als Sperrfläche ausgezont ist.
Das Wasser ist etwas trübe, manchmal kitzelt beim
Rausschwimmen auch mal eine stachlige Alge am Bauch. Ueber die
Wasserqualität des Brauiweihers wurden keine Ergebnisse publik
gemacht. "Weil hier bisher keine Probleme auchgetaucht sind,
dürfte die Wasserqualität gut sein." Das Seelein ist dann auch
nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Weiher in
Affoltern, der wegen Problemen mit Altlasten in die Medien
geraten ist. Auch an einem Mittwochnachmittag bei 26°C bleibt
es hier aber recht leer und friedlich. Und die umliegende
(Agrar-) Landschaft ist sehr schön und lädt ein für
Spatziergänge und Wanderungen.
|

